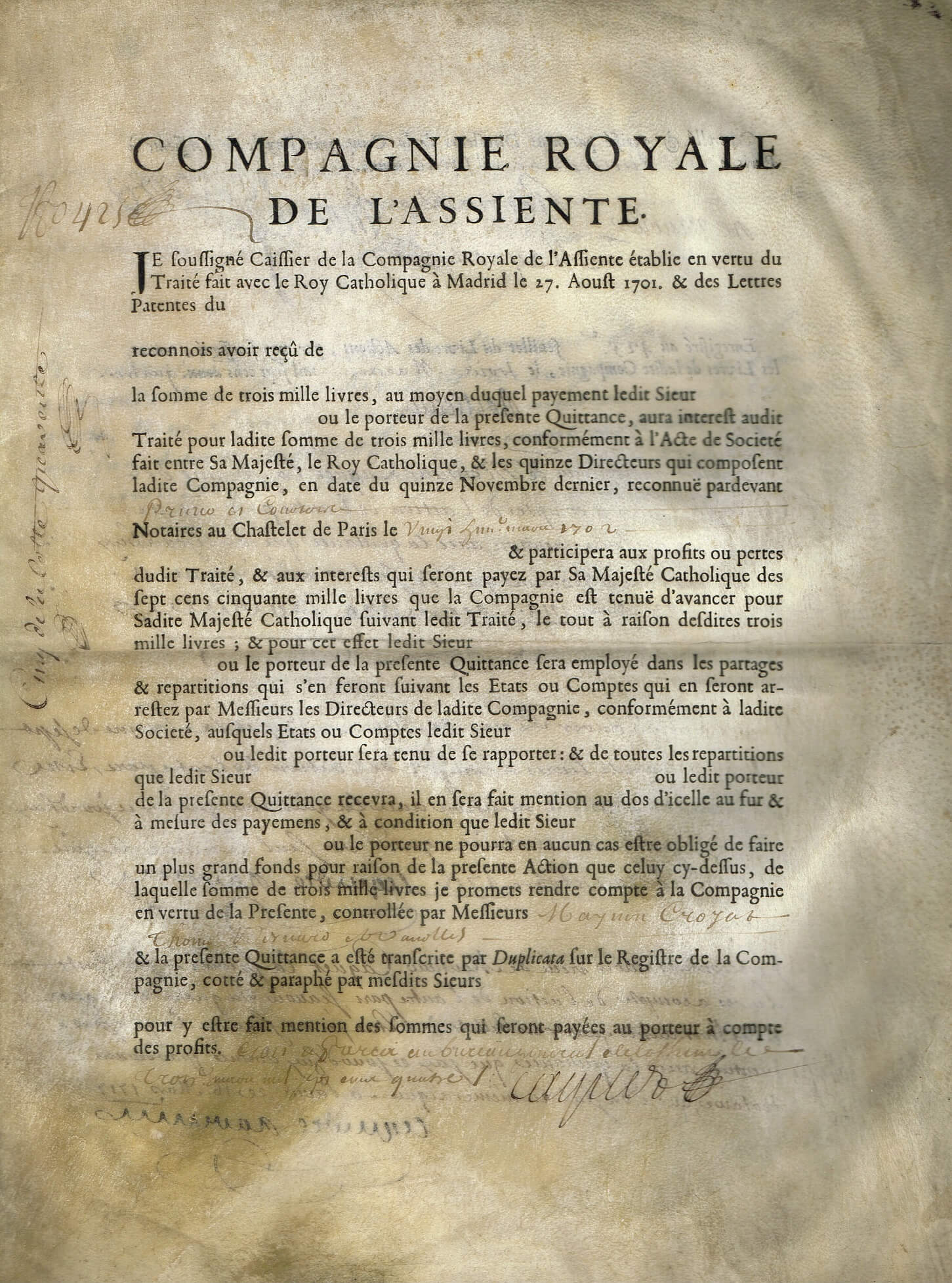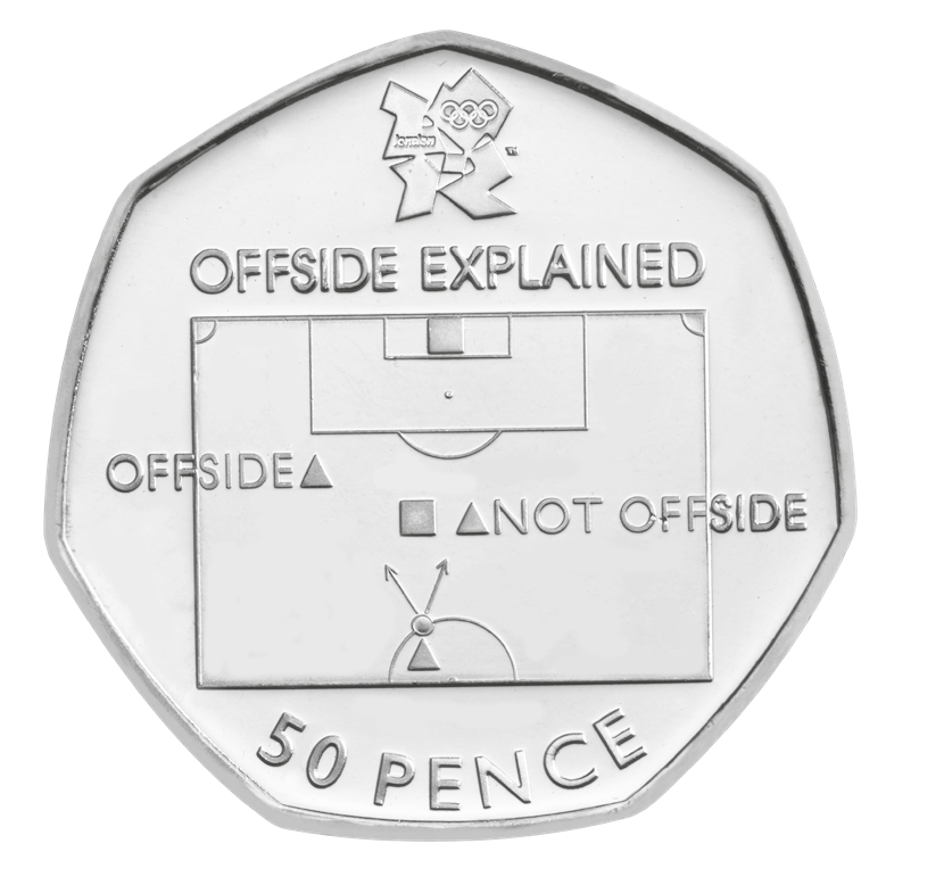Rekord der Woche

Die teuersten: Bayrischen Münzen und Medaillen
In unserer Rekordsektion reisen wir heute nach Bayern. Wir zeigen Ihnen die teuersten Münzen und Medaillen des Herzogtums, Kurfürstentums und Königreichs Bayern. Es erwarten Sie prächtige Mehrfachgoldmünzen!
alle Rekorde
die teuersten Münzen
 https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2024/04/2024KW15Rekord_00-1.jpg
523
1000
Peter Terhorst
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
Peter Terhorst2024-04-11 09:35:002024-04-11 09:46:35Die teuersten: Bayrischen Münzen und Medaillen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2024/04/2024KW15Rekord_00-1.jpg
523
1000
Peter Terhorst
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
Peter Terhorst2024-04-11 09:35:002024-04-11 09:46:35Die teuersten: Bayrischen Münzen und Medaillen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/12/2023KW49Rekord_07.jpg
486
1000
Peter Terhorst
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
Peter Terhorst2023-12-07 10:42:152023-12-07 11:03:15Die teuersten: Münzen der Ernestinischen Herzogtümer
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/12/2023KW49Rekord_07.jpg
486
1000
Peter Terhorst
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
Peter Terhorst2023-12-07 10:42:152023-12-07 11:03:15Die teuersten: Münzen der Ernestinischen Herzogtümer https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/11/2023KW47Rekord07.jpg
500
1000
Peter Terhorst
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
Peter Terhorst2023-11-23 10:17:402023-11-23 10:36:56Die teuersten: Münzen und Medaillen Bulgariens
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/11/2023KW47Rekord07.jpg
500
1000
Peter Terhorst
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
Peter Terhorst2023-11-23 10:17:402023-11-23 10:36:56Die teuersten: Münzen und Medaillen Bulgariens https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/10/02-38.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-10-27 08:43:112023-10-23 12:27:40Die teuersten: Sächsischen Münzen der Albertiner
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/10/02-38.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-10-27 08:43:112023-10-23 12:27:40Die teuersten: Sächsischen Münzen der Albertiner https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/08/08-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-08-25 13:56:372023-09-19 15:30:26Die teuersten: Münzen der Tschechoslowakei
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/08/08-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-08-25 13:56:372023-09-19 15:30:26Die teuersten: Münzen der Tschechoslowakei https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/06/06_image00833.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-06-16 13:56:422023-09-19 16:22:56Die teuersten: Münzen der Eidgenossenschaft
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/06/06_image00833.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-06-16 13:56:422023-09-19 16:22:56Die teuersten: Münzen der Eidgenossenschaft https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/05/03_image03396.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-05-26 13:56:152023-09-20 07:58:18Die teuersten: Münzen und Medaillen des modernen Griechenlands
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/05/03_image03396.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-05-26 13:56:152023-09-20 07:58:18Die teuersten: Münzen und Medaillen des modernen Griechenlands https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/04/06_image04412.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-04-21 13:56:132023-09-20 07:58:48Die teuersten: Münzen der Niederlande
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/04/06_image04412.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-04-21 13:56:132023-09-20 07:58:48Die teuersten: Münzen der Niederlande https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/03/09-6.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-03-17 14:00:512023-09-20 07:59:01Die teuersten: Münzen der Welt
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/03/09-6.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-03-17 14:00:512023-09-20 07:59:01Die teuersten: Münzen der Welt https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/01/07-6.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-01-27 13:56:322023-09-20 07:59:53Die teuersten: 2021 verkauften Münzen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/01/07-6.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-01-27 13:56:322023-09-20 07:59:53Die teuersten: 2021 verkauften Münzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/10/09_image03264.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-10-14 13:56:282023-09-20 08:00:05Die teuersten: Münzen und Medaillen der Hohenzollern
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/10/09_image03264.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-10-14 13:56:282023-09-20 08:00:05Die teuersten: Münzen und Medaillen der Hohenzollern https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/03/08-4.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-04-08 13:56:172023-09-20 08:02:10Die teuersten: Britischen Münzen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/03/08-4.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-04-08 13:56:172023-09-20 08:02:10Die teuersten: Britischen Münzen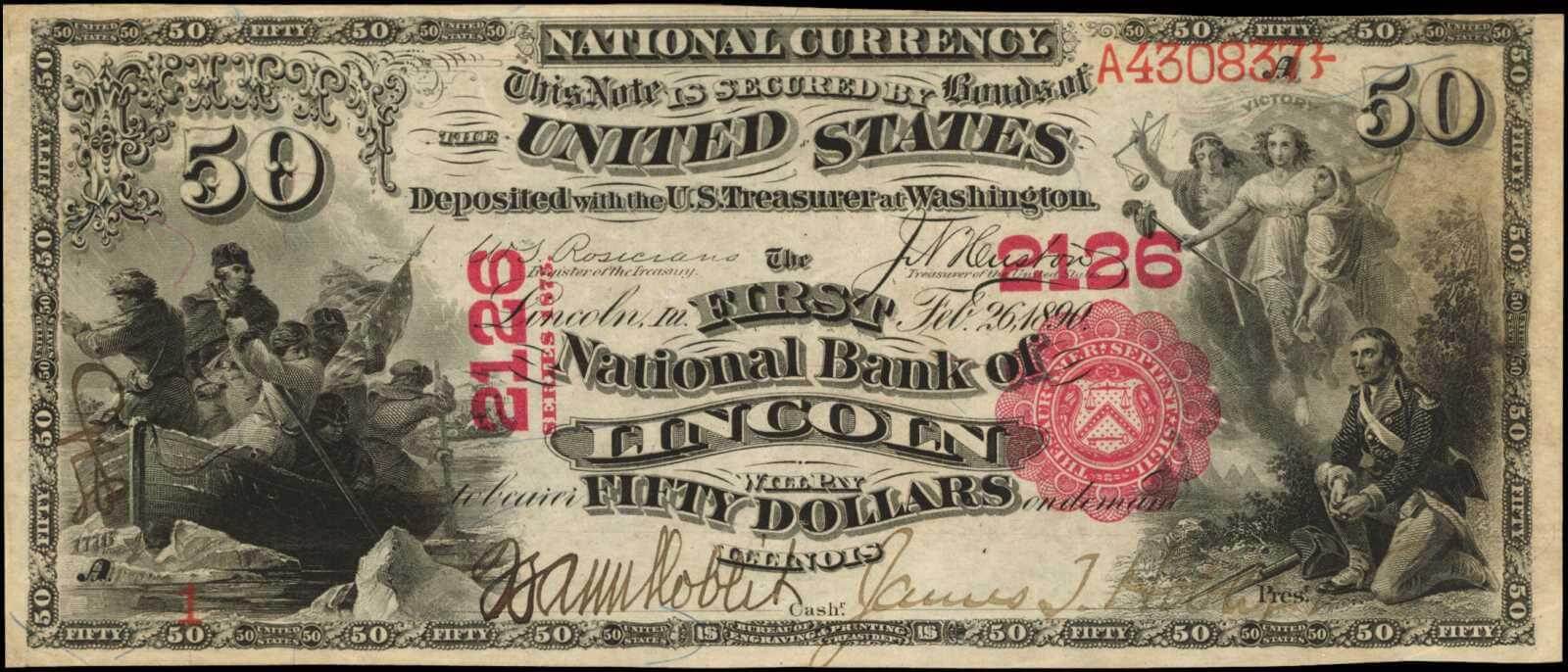 https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/01/03a.jpg
686
1600
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-01-28 13:56:322023-09-20 08:03:18Die teuersten: 2020 versteigerten US Banknoten
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/01/03a.jpg
686
1600
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-01-28 13:56:322023-09-20 08:03:18Die teuersten: 2020 versteigerten US Banknoten https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/01/08-6.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-01-21 13:56:592023-09-20 08:03:39Die teuersten: 2020 versteigerten US-Münzen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/01/08-6.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-01-21 13:56:592023-09-20 08:03:39Die teuersten: 2020 versteigerten US-Münzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/11/PantikapaionStater-1.jpg
500
1000
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-11-19 13:56:532023-09-19 15:37:13Die teuersten: Goldmünzen der Antike
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/11/PantikapaionStater-1.jpg
500
1000
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-11-19 13:56:532023-09-19 15:37:13Die teuersten: Goldmünzen der Antike https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/11/09-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-11-12 13:56:082023-09-20 08:04:47Die teuersten: Münzen des Deutschen Kaiserreichs
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/11/09-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-11-12 13:56:082023-09-20 08:04:47Die teuersten: Münzen des Deutschen Kaiserreichs https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/02-20.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-10-22 13:56:192023-09-20 08:04:56Die teuersten: Münzen aus Elektron
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/02-20.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-10-22 13:56:192023-09-20 08:04:56Die teuersten: Münzen aus Elektron https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/01-18.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-10-15 13:56:102023-09-20 08:05:10Die Teuersten: Doppeltaler des Heiligen Römischen Reiches
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/01-18.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-10-15 13:56:102023-09-20 08:05:10Die Teuersten: Doppeltaler des Heiligen Römischen Reiches https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00311-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-10-08 13:56:482023-09-20 08:05:20Die Teuersten: Taler des Heiligen Römischen Reichs
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00311-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-10-08 13:56:482023-09-20 08:05:20Die Teuersten: Taler des Heiligen Römischen Reichs https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/07-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-10-01 13:56:012023-09-20 08:06:23Die Teuersten: Brakteaten
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/07-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-10-01 13:56:012023-09-20 08:06:23Die Teuersten: Brakteaten https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/03-15.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-09-17 13:56:522023-09-20 08:06:32Die Teuersten: Römischen Denare
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/03-15.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-09-17 13:56:522023-09-20 08:06:32Die Teuersten: Römischen Denare https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/01-11.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-09-10 13:56:222023-09-20 08:06:40Die Teuersten: Tetradrachmen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/01-11.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-09-10 13:56:222023-09-20 08:06:40Die Teuersten: Tetradrachmen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/08.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-09-03 13:56:292023-09-20 08:07:34Die Teuersten: Russischen Münzen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/08.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-09-03 13:56:292023-09-20 08:07:34Die Teuersten: Russischen Münzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/08/10-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-08-27 13:56:442023-09-20 08:07:47Die Teuersten: Sesterzen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/08/10-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-08-27 13:56:442023-09-20 08:07:47Die Teuersten: Sesterzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00196.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-07-30 13:56:542023-09-20 08:07:57Die Teuersten: Renaissancemedaillen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00196.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-07-30 13:56:542023-09-20 08:07:57Die Teuersten: Renaissancemedaillen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00023-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-07-16 13:54:352023-09-20 08:08:52Die Teuersten: Aurei
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00023-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-07-16 13:54:352023-09-20 08:08:52Die Teuersten: Aureidie schönsten Münzen
 https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/11/2023KW44Rekord_00.jpg
500
1000
Peter Terhorst
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
Peter Terhorst2023-11-02 14:10:562023-11-02 16:22:15Die Schönsten: Keltische Münzen aus Britannien, ausgewählt von Tim Wright
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/11/2023KW44Rekord_00.jpg
500
1000
Peter Terhorst
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
Peter Terhorst2023-11-02 14:10:562023-11-02 16:22:15Die Schönsten: Keltische Münzen aus Britannien, ausgewählt von Tim Wright https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/08-3.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-07-09 13:56:492023-10-20 13:02:21Die Schönsten: Jüdische Medaillen ausgewählt von Mel Wacks
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/08-3.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-07-09 13:56:492023-10-20 13:02:21Die Schönsten: Jüdische Medaillen ausgewählt von Mel Wacks https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/06/01Syracuse-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-06-11 13:56:222023-10-25 04:09:24Die Schönsten: Münzen mit Darstellungen von Frauen, ausgewählt von Alain Baron und Philippe Veuve
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/06/01Syracuse-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-06-11 13:56:222023-10-25 04:09:24Die Schönsten: Münzen mit Darstellungen von Frauen, ausgewählt von Alain Baron und Philippe Veuve https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/03_00588q00.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-05-28 13:56:572023-09-20 08:10:52Die Schönsten: Römische Münzen ausgewählt von Yves Gunzenreiner
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/03_00588q00.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-05-28 13:56:572023-09-20 08:10:52Die Schönsten: Römische Münzen ausgewählt von Yves Gunzenreiner https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/09-5.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-05-21 13:56:252023-09-19 16:04:39Die Schönsten: Taler der Stadt Zürich ausgewählt von Ruedi Kunzmann
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/09-5.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-05-21 13:56:252023-09-19 16:04:39Die Schönsten: Taler der Stadt Zürich ausgewählt von Ruedi Kunzmann https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/02_set-mit-5-x-25-4562431-O.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-05-14 13:56:582023-09-20 08:12:37Die Schönsten: Chinesische Münzen nach 1970 ausgewählt von Werner Höpker
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/02_set-mit-5-x-25-4562431-O.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-05-14 13:56:582023-09-20 08:12:37Die Schönsten: Chinesische Münzen nach 1970 ausgewählt von Werner Höpker https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/01a.jpg
1080
1920
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-05-07 13:56:292023-09-20 08:12:53Die Schönsten: Bremer Münzen ausgewählt von Claus Müller
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/01a.jpg
1080
1920
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-05-07 13:56:292023-09-20 08:12:53Die Schönsten: Bremer Münzen ausgewählt von Claus Müller https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/02-32.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-04-30 13:56:562023-09-20 08:13:06Die Schönsten: Münzen der französischen Nationalbibliothek. Ausgewählt von Frédérique Duyrat
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/02-32.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-04-30 13:56:562023-09-20 08:13:06Die Schönsten: Münzen der französischen Nationalbibliothek. Ausgewählt von Frédérique Duyrat https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/01-13-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-04-16 13:56:342023-09-20 08:13:20Die Schönsten: Münzen der hellenistischen Herrscher. Ausgewählt von Peter van Alfen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/01-13-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-04-16 13:56:342023-09-20 08:13:20Die Schönsten: Münzen der hellenistischen Herrscher. Ausgewählt von Peter van Alfen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/02-12.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-04-09 13:56:392023-09-20 08:13:33Die schönsten: Münzen in Wien. Ausgewählt von Kurator*innen des Münzkabinetts
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/02-12.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-04-09 13:56:392023-09-20 08:13:33Die schönsten: Münzen in Wien. Ausgewählt von Kurator*innen des Münzkabinetts https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/04-1.jpg
574
1020
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-04-02 13:56:472023-09-20 08:13:52Die schönsten: Münzen und Medaillen im WeltenMuseum Hannover
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/04-1.jpg
574
1020
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-04-02 13:56:472023-09-20 08:13:52Die schönsten: Münzen und Medaillen im WeltenMuseum Hannover https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/03/01-14-scaled-1.jpg
1282
2560
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-03-26 11:30:552023-09-20 08:14:07Die Schönsten: Papstmedaillen ausgewählt von Kay Ehling
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/03/01-14-scaled-1.jpg
1282
2560
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-03-26 11:30:552023-09-20 08:14:07Die Schönsten: Papstmedaillen ausgewählt von Kay EhlingRekordauktionen
 https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/06/02-16-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-07-01 13:56:012023-09-19 15:31:53Rekordauktion: Heidelberger Münzhandlung Grün 81 & 82
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/06/02-16-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-07-01 13:56:012023-09-19 15:31:53Rekordauktion: Heidelberger Münzhandlung Grün 81 & 82 https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/05/06-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-05-06 14:00:562023-09-20 08:01:59Rekordauktion: Die Paramount Collection
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/05/06-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-05-06 14:00:562023-09-20 08:01:59Rekordauktion: Die Paramount Collection https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/11/2023KW44Rekord_00.jpg
500
1000
Peter Terhorst
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
Peter Terhorst2023-11-02 14:10:562023-11-02 16:22:15Die Schönsten: Keltische Münzen aus Britannien, ausgewählt von Tim Wright
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/11/2023KW44Rekord_00.jpg
500
1000
Peter Terhorst
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
Peter Terhorst2023-11-02 14:10:562023-11-02 16:22:15Die Schönsten: Keltische Münzen aus Britannien, ausgewählt von Tim Wright https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/08-3.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-07-09 13:56:492023-10-20 13:02:21Die Schönsten: Jüdische Medaillen ausgewählt von Mel Wacks
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/08-3.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-07-09 13:56:492023-10-20 13:02:21Die Schönsten: Jüdische Medaillen ausgewählt von Mel Wacks https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/06/01Syracuse-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-06-11 13:56:222023-10-25 04:09:24Die Schönsten: Münzen mit Darstellungen von Frauen, ausgewählt von Alain Baron und Philippe Veuve
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/06/01Syracuse-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-06-11 13:56:222023-10-25 04:09:24Die Schönsten: Münzen mit Darstellungen von Frauen, ausgewählt von Alain Baron und Philippe Veuve https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/03_00588q00.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-05-28 13:56:572023-09-20 08:10:52Die Schönsten: Römische Münzen ausgewählt von Yves Gunzenreiner
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/03_00588q00.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-05-28 13:56:572023-09-20 08:10:52Die Schönsten: Römische Münzen ausgewählt von Yves Gunzenreiner https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/09-5.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-05-21 13:56:252023-09-19 16:04:39Die Schönsten: Taler der Stadt Zürich ausgewählt von Ruedi Kunzmann
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/09-5.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-05-21 13:56:252023-09-19 16:04:39Die Schönsten: Taler der Stadt Zürich ausgewählt von Ruedi Kunzmann https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/02_set-mit-5-x-25-4562431-O.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-05-14 13:56:582023-09-20 08:12:37Die Schönsten: Chinesische Münzen nach 1970 ausgewählt von Werner Höpker
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/02_set-mit-5-x-25-4562431-O.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-05-14 13:56:582023-09-20 08:12:37Die Schönsten: Chinesische Münzen nach 1970 ausgewählt von Werner Höpker https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/01a.jpg
1080
1920
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-05-07 13:56:292023-09-20 08:12:53Die Schönsten: Bremer Münzen ausgewählt von Claus Müller
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/01a.jpg
1080
1920
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-05-07 13:56:292023-09-20 08:12:53Die Schönsten: Bremer Münzen ausgewählt von Claus Müller https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/02-32.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-04-30 13:56:562023-09-20 08:13:06Die Schönsten: Münzen der französischen Nationalbibliothek. Ausgewählt von Frédérique Duyrat
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/02-32.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-04-30 13:56:562023-09-20 08:13:06Die Schönsten: Münzen der französischen Nationalbibliothek. Ausgewählt von Frédérique Duyrat https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/01-13-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-04-16 13:56:342023-09-20 08:13:20Die Schönsten: Münzen der hellenistischen Herrscher. Ausgewählt von Peter van Alfen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/01-13-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-04-16 13:56:342023-09-20 08:13:20Die Schönsten: Münzen der hellenistischen Herrscher. Ausgewählt von Peter van Alfen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/02-12.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-04-09 13:56:392023-09-20 08:13:33Die schönsten: Münzen in Wien. Ausgewählt von Kurator*innen des Münzkabinetts
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/02-12.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-04-09 13:56:392023-09-20 08:13:33Die schönsten: Münzen in Wien. Ausgewählt von Kurator*innen des Münzkabinetts https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/04-1.jpg
574
1020
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-04-02 13:56:472023-09-20 08:13:52Die schönsten: Münzen und Medaillen im WeltenMuseum Hannover
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/04-1.jpg
574
1020
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-04-02 13:56:472023-09-20 08:13:52Die schönsten: Münzen und Medaillen im WeltenMuseum Hannover https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/03/01-14-scaled-1.jpg
1282
2560
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-03-26 11:30:552023-09-20 08:14:07Die Schönsten: Papstmedaillen ausgewählt von Kay Ehling
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/03/01-14-scaled-1.jpg
1282
2560
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-03-26 11:30:552023-09-20 08:14:07Die Schönsten: Papstmedaillen ausgewählt von Kay Ehling https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2024/04/2024KW15Rekord_00-1.jpg
523
1000
Peter Terhorst
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
Peter Terhorst2024-04-11 09:35:002024-04-11 09:46:35Die teuersten: Bayrischen Münzen und Medaillen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2024/04/2024KW15Rekord_00-1.jpg
523
1000
Peter Terhorst
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
Peter Terhorst2024-04-11 09:35:002024-04-11 09:46:35Die teuersten: Bayrischen Münzen und Medaillen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/12/2023KW49Rekord_07.jpg
486
1000
Peter Terhorst
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
Peter Terhorst2023-12-07 10:42:152023-12-07 11:03:15Die teuersten: Münzen der Ernestinischen Herzogtümer
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/12/2023KW49Rekord_07.jpg
486
1000
Peter Terhorst
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
Peter Terhorst2023-12-07 10:42:152023-12-07 11:03:15Die teuersten: Münzen der Ernestinischen Herzogtümer https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/11/2023KW47Rekord07.jpg
500
1000
Peter Terhorst
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
Peter Terhorst2023-11-23 10:17:402023-11-23 10:36:56Die teuersten: Münzen und Medaillen Bulgariens
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/11/2023KW47Rekord07.jpg
500
1000
Peter Terhorst
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
Peter Terhorst2023-11-23 10:17:402023-11-23 10:36:56Die teuersten: Münzen und Medaillen Bulgariens https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/10/02-38.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-10-27 08:43:112023-10-23 12:27:40Die teuersten: Sächsischen Münzen der Albertiner
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/10/02-38.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-10-27 08:43:112023-10-23 12:27:40Die teuersten: Sächsischen Münzen der Albertiner https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/08/08-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-08-25 13:56:372023-09-19 15:30:26Die teuersten: Münzen der Tschechoslowakei
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/08/08-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-08-25 13:56:372023-09-19 15:30:26Die teuersten: Münzen der Tschechoslowakei https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/06/06_image00833.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-06-16 13:56:422023-09-19 16:22:56Die teuersten: Münzen der Eidgenossenschaft
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/06/06_image00833.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-06-16 13:56:422023-09-19 16:22:56Die teuersten: Münzen der Eidgenossenschaft https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/05/03_image03396.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-05-26 13:56:152023-09-20 07:58:18Die teuersten: Münzen und Medaillen des modernen Griechenlands
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/05/03_image03396.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-05-26 13:56:152023-09-20 07:58:18Die teuersten: Münzen und Medaillen des modernen Griechenlands https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/04/06_image04412.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-04-21 13:56:132023-09-20 07:58:48Die teuersten: Münzen der Niederlande
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/04/06_image04412.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-04-21 13:56:132023-09-20 07:58:48Die teuersten: Münzen der Niederlande https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/03/09-6.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-03-17 14:00:512023-09-20 07:59:01Die teuersten: Münzen der Welt
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/03/09-6.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-03-17 14:00:512023-09-20 07:59:01Die teuersten: Münzen der Welt https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/01/07-6.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-01-27 13:56:322023-09-20 07:59:53Die teuersten: 2021 verkauften Münzen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/01/07-6.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2022-01-27 13:56:322023-09-20 07:59:53Die teuersten: 2021 verkauften Münzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/10/09_image03264.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-10-14 13:56:282023-09-20 08:00:05Die teuersten: Münzen und Medaillen der Hohenzollern
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/10/09_image03264.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-10-14 13:56:282023-09-20 08:00:05Die teuersten: Münzen und Medaillen der Hohenzollern https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/03/08-4.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-04-08 13:56:172023-09-20 08:02:10Die teuersten: Britischen Münzen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/03/08-4.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-04-08 13:56:172023-09-20 08:02:10Die teuersten: Britischen Münzen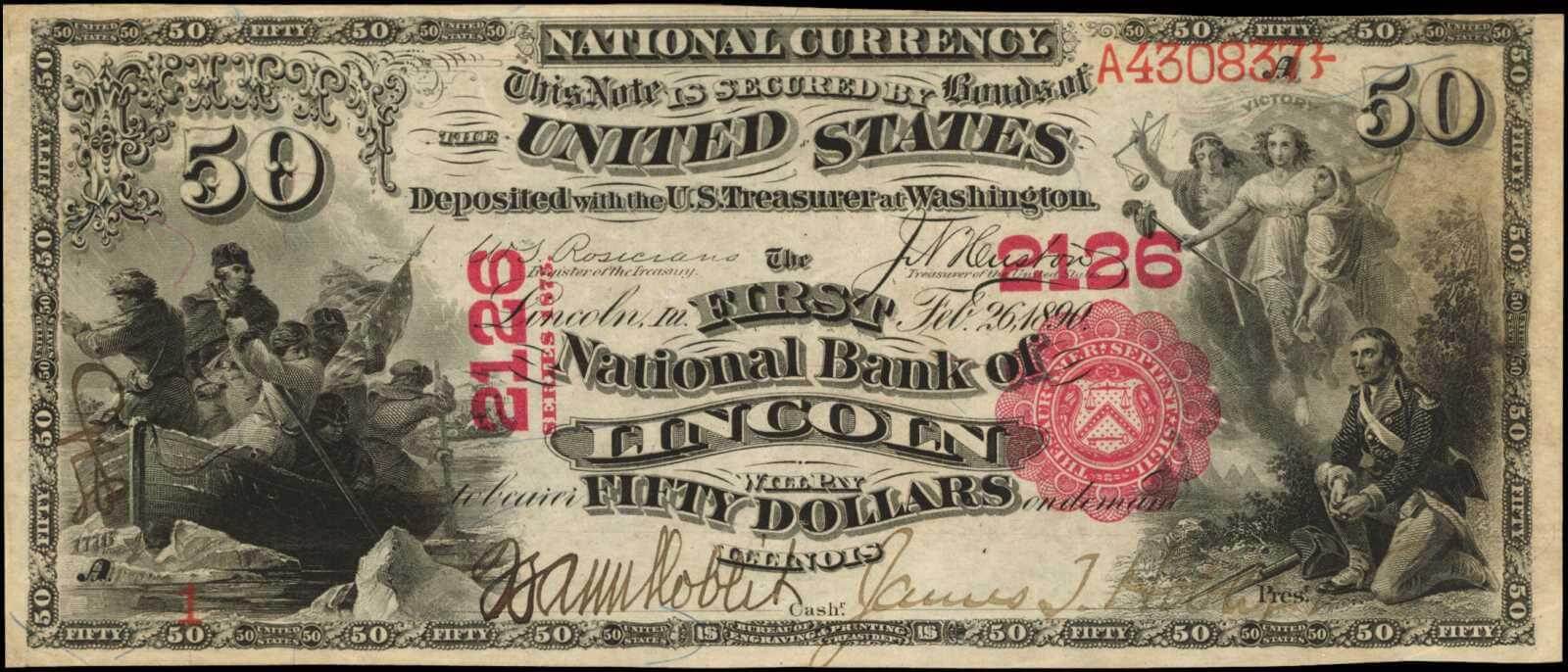 https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/01/03a.jpg
686
1600
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-01-28 13:56:322023-09-20 08:03:18Die teuersten: 2020 versteigerten US Banknoten
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/01/03a.jpg
686
1600
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-01-28 13:56:322023-09-20 08:03:18Die teuersten: 2020 versteigerten US Banknoten https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/01/08-6.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-01-21 13:56:592023-09-20 08:03:39Die teuersten: 2020 versteigerten US-Münzen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/01/08-6.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-01-21 13:56:592023-09-20 08:03:39Die teuersten: 2020 versteigerten US-Münzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/11/PantikapaionStater-1.jpg
500
1000
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-11-19 13:56:532023-09-19 15:37:13Die teuersten: Goldmünzen der Antike
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/11/PantikapaionStater-1.jpg
500
1000
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-11-19 13:56:532023-09-19 15:37:13Die teuersten: Goldmünzen der Antike https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/11/09-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-11-12 13:56:082023-09-20 08:04:47Die teuersten: Münzen des Deutschen Kaiserreichs
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/11/09-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-11-12 13:56:082023-09-20 08:04:47Die teuersten: Münzen des Deutschen Kaiserreichs https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/02-20.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-10-22 13:56:192023-09-20 08:04:56Die teuersten: Münzen aus Elektron
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/02-20.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-10-22 13:56:192023-09-20 08:04:56Die teuersten: Münzen aus Elektron https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/01-18.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-10-15 13:56:102023-09-20 08:05:10Die Teuersten: Doppeltaler des Heiligen Römischen Reiches
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/01-18.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-10-15 13:56:102023-09-20 08:05:10Die Teuersten: Doppeltaler des Heiligen Römischen Reiches https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00311-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-10-08 13:56:482023-09-20 08:05:20Die Teuersten: Taler des Heiligen Römischen Reichs
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00311-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-10-08 13:56:482023-09-20 08:05:20Die Teuersten: Taler des Heiligen Römischen Reichs https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/07-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-10-01 13:56:012023-09-20 08:06:23Die Teuersten: Brakteaten
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/07-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-10-01 13:56:012023-09-20 08:06:23Die Teuersten: Brakteaten https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/03-15.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-09-17 13:56:522023-09-20 08:06:32Die Teuersten: Römischen Denare
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/03-15.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-09-17 13:56:522023-09-20 08:06:32Die Teuersten: Römischen Denare https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/01-11.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-09-10 13:56:222023-09-20 08:06:40Die Teuersten: Tetradrachmen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/01-11.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-09-10 13:56:222023-09-20 08:06:40Die Teuersten: Tetradrachmen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/08.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-09-03 13:56:292023-09-20 08:07:34Die Teuersten: Russischen Münzen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/08.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-09-03 13:56:292023-09-20 08:07:34Die Teuersten: Russischen Münzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/08/10-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-08-27 13:56:442023-09-20 08:07:47Die Teuersten: Sesterzen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/08/10-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-08-27 13:56:442023-09-20 08:07:47Die Teuersten: Sesterzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00196.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-07-30 13:56:542023-09-20 08:07:57Die Teuersten: Renaissancemedaillen
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00196.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-07-30 13:56:542023-09-20 08:07:57Die Teuersten: Renaissancemedaillen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00023-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-07-16 13:54:352023-09-20 08:08:52Die Teuersten: Aurei
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00023-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2020-07-16 13:54:352023-09-20 08:08:52Die Teuersten: Aurei https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/06/02-16-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-07-01 13:56:012023-09-19 15:31:53Rekordauktion: Heidelberger Münzhandlung Grün 81 & 82
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/06/02-16-1.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-07-01 13:56:012023-09-19 15:31:53Rekordauktion: Heidelberger Münzhandlung Grün 81 & 82 https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/05/06-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-05-06 14:00:562023-09-20 08:01:59Rekordauktion: Die Paramount Collection
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/05/06-2.jpg
540
960
https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png
2021-05-06 14:00:562023-09-20 08:01:59Rekordauktion: Die Paramount Collection