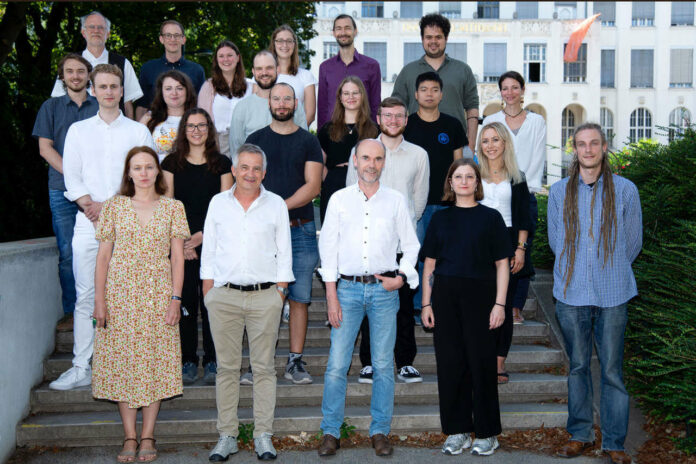Nach einer langen Corona-Pause versammelten sich vom 1. bis zum 12. August 2022 endlich wieder Numismatik-Begeisterte aus aller Welt in Wien: Aus der Schweiz, Österreich, Deutschland und gar aus China reisten die Studierenden an das Institut für Numismatik und Geldgeschichte. So divers wie ihre akademischen Hintergründe, vom Studenten im 2. Semester des Lehramts für Deutsch und Geschichte bis hin zu Mitarbeitenden im Münzkabinett, so konnten auch ihre numismatischen Interessensgebiete unterschiedlicher nicht sein: von der Münzprägung hellenistischer Herrscher, über die Numismatik des Orients bis hin zum Verbreitungsgebiet des österreichischen Guldens.
Durch diese wunderbare Diversität der Interessen und durch den warmen Empfang am Institut war der Austausch unter den Teilnehmenden selbst, aber auch zwischen Teilnehmenden und Referent*innen besonders anregend und erkenntnisreich. Wir alle kamen nach Wien mit dem Ziel, tiefer in die Welt der Numismatik einzutauchen und von dem fantastischen Angebot an Vorträgen und Exkursionen, die das Sommerseminar bietet, zu profitieren.
Die Vortragsreihe startete auch sogleich am ersten Tag. Nach einer herzlichen Begrüßung aller Teilnehmenden und einer Führung durch das Institut, die uns Einblicke hinter die Kulissen gewährte und bei der wir alle Mitarbeiter*innen des Instituts kennenlernten, erhielten wir von Hubert Emmerig eine einleitende Vorlesung zum Wesen, Umfang und der Geschichte des Faches Numismatik, sowie zur Geschichte des Wiener Instituts. Am Nachmittag folgte schließlich ein Überblick über die chronologische Entwicklung des Münzrechts, des Münzbetriebs und der Münztechnik im Laufe der Jahrtausende von Herrn Emmerig und Marc Philipp Wahl. Herr Wahl war es auch, der uns anschließend eine Einführung zum Geld und der Münze in der griechischen Welt gab, bevor wir schließlich den gelungenen ersten Tag des Sommerseminars mit einem gemeinsamen Abendessen ausklingen ließen. Am nächsten Tag setzte sich die Vortragsreihe fort und thematisierte das Geld in der römischen Welt: so stellte uns Bernhard Woytek die republikanische und kaiserzeitliche Münzprägung vor, gefolgt von einem Beitrag von Klaus Vondrovec zum Geld in der Spätantike.

Am Nachmittag folgte schließlich der wohl aufregendste Teil des Seminars: die Arbeit mit den Originalen aus der Sammlung. Mittels genauster Analyse der Stücke und der systematischen Arbeit mit der relevanten Literatur bekamen wir die Möglichkeit, antike Originale hautnah zu erleben und diese korrekt und eigenständig zu bestimmen. Am nächsten Tag stellte uns Ehsan Shavarebi schließlich in seiner Vorlesung die Münzprägung des Alten Orients vor und brachte uns die orientalische Numismatik näher, welche sich am Institut für Numismatik und Geldgeschichte bereits einer langen Tradition erfreut. Im Anschluss gewährte uns Anna Lörnitzo einen Einblick zur Medaillenkunde – welche für die meisten Teilnehmer noch gänzliches Neuland war und daher auf große Neugierde stieß. Die chronologische Führung durch alle Teilgebiete der Numismatik setzten schließlich Johannes Hartner, sowie Lilia Dergaciova fort, indem sie uns eine Einführung zur Münze und dem Geld im europäischen Mittelalter gaben.
Herr Hubert Emmerig rundete letztendlich den zeitlichen Durchlauf mit einer Vorlesung zur Münzprägung der Neuzeit ab, bevor schließlich wiederum ein Nachmittag der Münzbestimmung anhand ausgewählter Beispiele der Institutssammlung folgte, um das vermittelte Wissen zu festigen und praktisch anzuwenden. Wir wurden im Anschluss zu einem gemütlichen Beisammensein im Innenhof des Instituts eingeladen, bei dem der rege Austausch und die geteilte Freude an der Numismatik im Mittelpunkt standen.
Mit einem Blick über den numismatischen Tellerrand hinaus wartete der Freitag auf. Der Bauforscher Paul Mitchell nahm uns mit auf eine Reise zu Überresten des mittelalterlichen Wien. Was zunächst wie ein Selbstläufer klingt, bedurfte jedoch eines guten Auges. Die Wiener Altstadt prägen Fassaden von Barock bis Jugendstil und Nachkriegszeit. Mittelalter und Renaissance zeigen sich meist nur in kleinen Details oder versteckt in Innenhöfen und Durchfahrten. Bei hochsommerlichem Wetter starteten wir früh unseren Rundgang am prächtigen, immer vollen Stephansdom, knapp außerhalb der Mauern des einstigen Römerkastells. Dort begegneten wir in Form der heutigen Prinz-Eugen-Kapelle auch dem ersten Numismatik-Bezug. Denn die bedeutende spätmittelalterliche Stifterfamilie Tirna stellte nicht nur Bürgermeister, sondern auch Münzmeister im mittelalterlichen Wien. Weiter ging unser Weg ins Stubenviertel, nahe beim alten Hohen Marktplatz. Hier wohnte einst die Stadtelite, so auch besagte Familie Tirna. Wir staunten über die Trick-Track-Partie einer sehschwachen Kuh mit einem Hund an einer Fassade einerseits und wie viele Informationen eine unscheinbare, unverputzte Mauer in sich bergen kann, andererseits. Hier war auch der richtige Ort, um auf einst markante Bauten der Stadt zu verweisen, die heute verloren oder marginalisiert sind: Wohn- oder Geschlechtertürme. Die Silhouette Wiens ähnelte einst der Regensburgs, doch die Jahrhunderte ließen die Türme durch Abbruch oder Wachstum der umgebenden Gebäude aus dem Stadtbild (fast) verschwinden. Über die Griechengasse und Ruprechtskirche führte uns der Weg zum einstigen Judenviertel, an der heute ein Denkmal den Ort der alten Synagoge zeigt. Direkt angrenzend präsentierte sich das alte Zentrum Babenberger Stadtherrschaft in Wien in mittäglicher Hitze: der Platz „Am Hof“. Von da nahmen wir den Weg zurück durch die Gassen in Richtung St. Stephan. In der nur noch unterirdisch erhaltenen und mit kleinem Museum ausgestatteten Wallfahrts- und Friedhofskapelle St. Virgil am Stephansplatz endete unser aufschlussreicher und unterhaltsamer Rundgang durch das alte Wien. Es schlossen sich ein freier Nachmittag und das Wochenende an, die dazu einluden das Gelernte und Gesehene sacken zu lassen und Wien kulinarisch und kulturell näher kennen zu lernen.

Die zweite Woche begann, wie die erste geendet hatte: mit Mittelalter. Nur hatte ein Zwischentief kurzzeitig für eine ersehnte Abkühlung gesorgt. Mit voller Kraft entführte uns Hubert Emmerig ins spätmittelalterliche Bayern, wobei der Landesname politische Einheitlichkeit lediglich vortäuscht. Neben verschiedenen Herzogslinien mit eigenen Zielen betrieben im bayerischen Raum auch andere Mächte ihre eigene (Münz-)Politik: Reichsstädte, Grafen oder Bischöfe. Ein Zurechtfinden fiel und fällt da Ungeübten ebenso schwer wie bei der Nominalvielfalt. Eine besondere Herausforderung für unser Seminar stellten die Schriftquellen dar, die es zu bearbeiten galt. Münzen hatten wir in Wien schon häufiger in die Hand bekommen, aber ein Münztagungsprotokoll oder einen Urfehdebrief? Fehlanzeige! Ein Stolperstein war nicht zuletzt die Quellensprache, kein Latein oder Griechisch kam hier zur Anwendung, sondern Frühneuhochdeutsch in süddeutsch-bairischer Dialektfärbung. So arbeiteten sich verschiedene Kleingruppen durch die Urkunden, Informantenberichte und Chroniken. Der zeitliche Schwerpunkt lag auf der sogenannten Schinderlingszeit Ende der 1450er Jahre, geprägt durch massive Münzverschlechterung und Geldentwertung. Am Ende standen neben einigen Missverständnissen und offenen Interpretationen vor allem Erkenntnisse aus dem Quellenstudium: Etwa, wie schwierig sich die Organisation einer landschaftlich einheitlichen Münzprägung gestaltete, mit ewigen Verhandlungen, Sendschreiben, Instruktionen und Bevollmächtigten, bis am Ende (hoffentlich) ein Münzvertrag stand. Ob dieser dann eingehalten wurde, war eine ganz andere Frage. Um dies herauszufinden, scheute man sich nicht auch Spione in die anderen Territorien zu schicken und auch der eigenen Verwandtschaft traute man (gerade?) nicht. Abseits der konkreten Impressionen aus dem Bayern des 15. Jahrhunderts, war insbesondere der hohe Stellenwert der Schriftquellen für die Numismatik und Geldgeschichte der Zeit eindrücklich erfahrbar.

Der folgende Dienstag gehört dann wieder ganz der Antike. Mit Markus Peter und Kathrin Siegl waren zwei Parktiker*innen geladen, um über Fundmünzen zu referieren. Dabei konnten wir erfahren, wie sich etwa in Kaiseraugst die Geschichte des römischen Reiches in den Provinzen wiederspiegelt. Etwa der massive Kleingeldmangel um Christi Geburt oder die Verschlechterung der Münzen, was sich beides konkret in den Funden niederschlug. Interessant war zudem die Erkenntnis, dass Einzelfunde deutlich gegenüber Horten dominieren und keinesfalls immer als Verlust angesehen werden können sowie die Übung zur Interpretation verschiedener Horte aus dem Schweizer Raum. Den Fokus auf Österreich legte Kathrin Siegl mit den Fundmünzen aus den verschiedensten archäologischen Zusammenhängen. Sie verband die Vorstellung ihrer Arbeit vor allem mit dem dringenden Plädoyer die Funde im Rahmen des Denkmalschutzansatzes in ihren Kontexten zu bewahren und als wertvolle Quellen nutzbar zu machen. Beide Vorträge wurden durch ein Koreferat von Reinhard Wolters eingebettet, der u.a. noch auf umfangreiche Online-Datenbanken zu Hortfunden verwies. Am Abend entführte uns Wolfgang Fischer-Bossert dann in die Frühzeit der Münzprägung. Anhand der frühen Elektron- und Bimetallprägungen Lydiens und verschiedenster literarischer wie ikonographischer Quellen versuchte er Licht in die Chronologie der frühesten Prägeherren zu bringen. Im Anschluss lud ein weiterer gemütlicher Abend bei Pizza und Getränken im Instituts-Innenhof dazu ein, das Gehörte zu diskutieren und eine weitere laue Wiener Sommernacht mit der tollen Seminargruppe zu verbringen.
Am Mittwochmorgen trafen wir bei wieder hochsommerlichen Temperaturen um neun Uhr vor der Österreichischen Nationalbank ein, mittlerweile routiniert darin, dass auf lange Abende frühe Morgen folgten. Michael Grundner vom Geldmuseum der Österreichischen Nationalbank begrüßte uns vor Ort und führte zunächst vor dem imposanten Gebäude in dessen Geschichte sowie die Geschichte der Nationalbank ein. Währenddessen verschwand im Hintergrund ein Geldtransporter per Aufzug im Untergrund, sodass gleich klar wurde, dass das Gebäude nicht bloßen Repräsentationszwecken diente, sondern von hier aus ein wichtiger Beitrag zur Sicherstellung der Bargeldversorgung des Landes geleistet wird.
Nach der kurzen historischen Einführung betraten wir die Räumlichkeiten des Geldmuseums. Die dortige Dauerausstellung führte in Siebenmeilenstiefeln durch die Geschichte des Geldes, von prämonetären Zahlungsmitteln bis hin zur modernen Kreditkarte, in späterer Zeit natürlich mit einem Schwerpunkt auf Österreich. Die in den bisherigen anderthalb Wochen des Sommerseminars erworbenen Kenntnisse zeigten hier bereits erste Früchte, erschien doch vieles mittlerweile altbekannt, bis hin zu manch ausgestelltem Münztyp. Die Sonderausstellung „Euro Cash. 20 Jahre Euro-Banknoten und Euro-Münzen“ widmete sich dann einer im Vergleich zur Dauerausstellung doch sehr überschaubaren Zeitspanne. Von ersten Entwürfen von Euro-Münzen und -Geldscheinen, die noch aus der Prä-Euro-Zeit stammten, bis hin zu den aktuellen nationalen Gedenkmünzen gab es von allem etwas zu bestaunen. Die seit der Einführung des Euros vergangene Zeit zeigte sich noch einmal deutlich darin, dass eine nicht geringe Anzahl der Teilnehmenden schon nicht mehr bewusst mit den damaligen Landeswährungen in Kontakt gekommen war.
Zum Abschluss unseres Besuchs folgte ein spannender Teil bezüglich Ausstellungskonzeption und Museumsdidaktik. Da ein großer Teil der Besucher*innen des Geldmuseums aus Schulklassen der unteren Klassenstufen besteht, gilt es hier natürlich andere Dinge zu beachten, als wenn gestandene oder angehende Numismatiker*innen den Großteil der Besucher*innen stellen würden. Anhand einer „Schatzkiste“ wurde uns erklärt, wie man eine Schulklasse an die Geschichte des Geldes heranführt und sie gleichzeitig dabei in den Lernprozess einbindet. Getragen von vielen interessierten Nachfragen und der offenkundigen Begeisterung Herrn Grundners entwickelte sich ein reges Gespräch zu einem Thema, mit dem die meisten Teilnehmenden bisher nicht oder nur wenig in Kontakt gekommen waren.
Am Nachmittag ging es dann wieder zurück ins Institut, wo Reinhard Wolters zunächst über die „Wiener Schule“ referierte. Bereits hier gab es manch spannenden Exkurs in die römische Münzgeschichte, bevor wir uns im zweiten Teil des Nachmittags gänzlich jener widmeten. Unter dem Titel „Schriftliche Quellen zur römischen Münz- und Geldgeschichte“ erfuhren wir nicht nur einiges über die Quellenlage, sondern über das römische Geldwesen an sich. Auch bekamen wir Einblicke in den Aufbau des römischen Steuerwesens und dessen Veränderungen über die Zeit und in den Aufbau und die Zusammensetzung des römischen Staatsschatzes. Ein Highlight hier war die Soldabrechnung eines römischen Legionärs der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts n. Chr., dessen Sold ihm nicht in bar ausgezahlt wurde, sondern mit seinem Sold bzw. seinem Vermögen der vorangehenden Jahre verrechnet und diesem dann in einer einem Girokonto nicht unähnlich anmutenden Art und Weise gutgeschrieben wurden.
Der Vormittag des Donnerstags war zwar laut Programm als Freizeit gedacht, doch die Begeisterung der Teilnehmenden schien weiterhin ungebrochen, als sich eine große Zahl zu einer freiwilligen Münzbestimmungsübung im Institut einfand. Ursprünglich als antike Bestimmungsübung gedacht, bestanden am Ende erneut mannigfaltige Möglichkeiten Münzen zu bestimmen; denn offensichtlich war die Begeisterung der Lehrenden ebenso ungetrübt, sodass letztendlich weitere Bestimmungsübungen bis hin ins Mittelalter angeboten und wahrgenommen wurden.
Am Nachmittag stand der Besuch des Münzkabinetts im Kunsthistorischen Museum an, zu dem Direktor Klaus Vondrovec geladen hatte. Wir wurden über einen Seiteneingang des altehrwürdigen Gebäudes in den zweiten Stock geführt, in dem sich die Räumlichkeiten des Münzkabinetts befinden. Unter den gestrengen Blicken seiner Vorgänger, die aus ihren Portraits auf uns hinabschauten, erfuhren wir etwas über Aufbau und Geschichte des Kabinetts ebenso wie über die momentan zu erledigenden und die in Zukunft anstehenden Aufgaben. Schnell wurde klar, dass wie so oft der Tag manch Stunde mehr haben dürfte und die Liste der Mitarbeitenden gern um ein paar DIN A 4 Seiten erweitert werden dürfte, damit allein die Riesenaufgabe der Digitalisierung der Bestände nicht die Dauer mehrerer Menschenleben in Anspruch nehmen wird. Im Anschluss wurden wir in die Ausstellungsräume des Münzkabinetts im Kunsthistorischen Museum entlassen, welches nun frei von uns besucht werden konnte. Allein die schiere Menge der sich dort befindlichen Sammlungen ist beeindruckend und wird wohl nur von deren Qualität übertroffen; hier ist mit Sicherheit für alle etwas dabei gewesen.
Der Abschlusstag stand dann ganz im Zeichen zweier Exkursionen. Von einem Reisebus wurden direkt vor der Unterkunft abgeholt und fuhren zunächst Richtung Carnuntum. Dort machten wir zuerst im Museum Carnuntinum in Bad Deutsch-Altenberg halt, welches sich in einer liebevoll rekonstruierten Villa befindet. Nach einer Führung durch das Museum ging es weiter in den archäologischen Park in Petronell-Carnuntum. Dort wurde aufgrund des an jenem Wochenende stattfindenden „Fests der Spätantike“ ebenjene greifbar, denn Carnuntum füllte sich bereits mit den Mitwirkenden, die an ihrer spätantiken Kleidung nachempfundenen Gewändern, den errichteten Zeltstädten oder auch den patrouillierenden Legionären erkennbar waren. Dies führte zu manchem Schmunzeln, etwa wenn das eigene spätantike Aussehen mit einem nicht ganz so spätantiken Smartphone als Selbstportrait festgehalten wurde, oder aber zu manch einer Ablenkung, wenn die Führung kurzzeitig in Anbetracht lieblicher Lautenklänge sowie dem nicht minder lieblichen Gesang in den Hintergrund der Aufmerksamkeit geriet. Ja sogar der Kaiser selbst war vor Ort, wie Kolleg*innen nach einer gewährten Audienz bei diesem zu berichten wussten. Ein Highlight des Besuchs war der Gang durch die Thermen Carnuntums, in denen die Heizkraft einer römischen Fußbodenheizung durch Rekonstruktionen lebhaft spürbar wurde und die hochsommerlichen Außentemperaturen dagegen zu einer willkommenen Erfrischung verblassen ließ. Nach Beendigung der Führung hatten wir noch einmal gut zwei Stunden Zeit, Carnuntum wie auch die Umgebung frei zu erkunden; dem kurzen Marsch zum Heidentor stand also nichts entgegen.
Nach einem Zwischenstopp im außerhalb des Parks gelegenen Amphitheater begann die zweite Etappe unseres Exkursionstages und wir fuhren nach Schloss Hof. Die dortige Führung war eine wahre Freude, denn unser Führer strotzte nicht nur vor Begeisterung und Leidenschaft, sondern verstand es auch sehr genau, diese auf sein Publikum übergehen zu lassen. Die dortige Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“, die uns ganz nebenbei noch einmal daran erinnerte, dass aus Porzellan nicht nur Medaillen gemacht werden können, brachte er uns ebenso nah wie seine Bewunderung für Prinz Eugens von Savoyen, der wesentlich zu Bau des Schlosses beigetragen hatte. Im Anschluss an die Besichtigung der Sonderausstellung und die Führung durch das barocke Schloss galt es noch die weitläufigen und einladenden Gärten zu erkunden; es wurden Irrgärten bezwungen, Esel und Ziesel befreundet, die gesamte Anlage bestaunt.
Die Rückfahrt nach Wien wurde dann von einigen effizient für ein kurzes Nickerchen genutzt, um ein paar Kraftreserven vor dem anstehenden letzten Abend zu mobilisieren. Der Bus fuhr uns sogleich zu einem Heurigen, der als Ort für den gemütlichen Ausklang eines Sommerseminares in Wien natürlich stilecht gewählt worden war. Dort wurden wir bereits von einer großen Zahl der teilnehmenden Dozierenden ebenso wie von kühlem Wein und warmem Essen erwartet. Kurzum, alles war für den durch und durch gelungenen Abschluss zweier lehrreicher Wochen bereitet, zu dem der Abend werden sollte. Und an den sich langsam im Verlaufe des Abends bemerkbar machenden Vorboten der Melancholie wurde langsam klar, dass nun nicht nur zwei Wochen des intensiven Lernens und Austausches, sondern auch zwei Wochen, die quasi als Gruppe verbracht worden waren und die manche Freundschaft hervorgebracht hatten, nun hier ihr Ende fanden.
Zum Abschluss soll hier noch einmal im Namen aller Teilnehmenden unser aufrichtiger Dank an alle Beteiligten zum Ausdruck gebracht werden. Er gilt den Institutsinternen wie -externen, den Führer*innen in den Museen, den Sponsoren und Unterstützern, kurzum allen, die uns das 11. Numismatische Sommerseminar in dieser Form ermöglicht haben. Vom ersten Moment an haben wir uns überall durchgängig willkommen und herzlich aufgenommen gefühlt und gewiss werden einige von uns einen Besuch im Institut für kommenden Wienaufenthalte fest vorgemerkt haben.
Besuchen Sie hier die Website des Instituts für Numismatik und Geldgeschichte Wien.
Letztes Jahr berichteten wir vom 150. Jubiläum der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft.
Lesen Sie mehr über Reinhard Wolters und Hubert Emmerig.